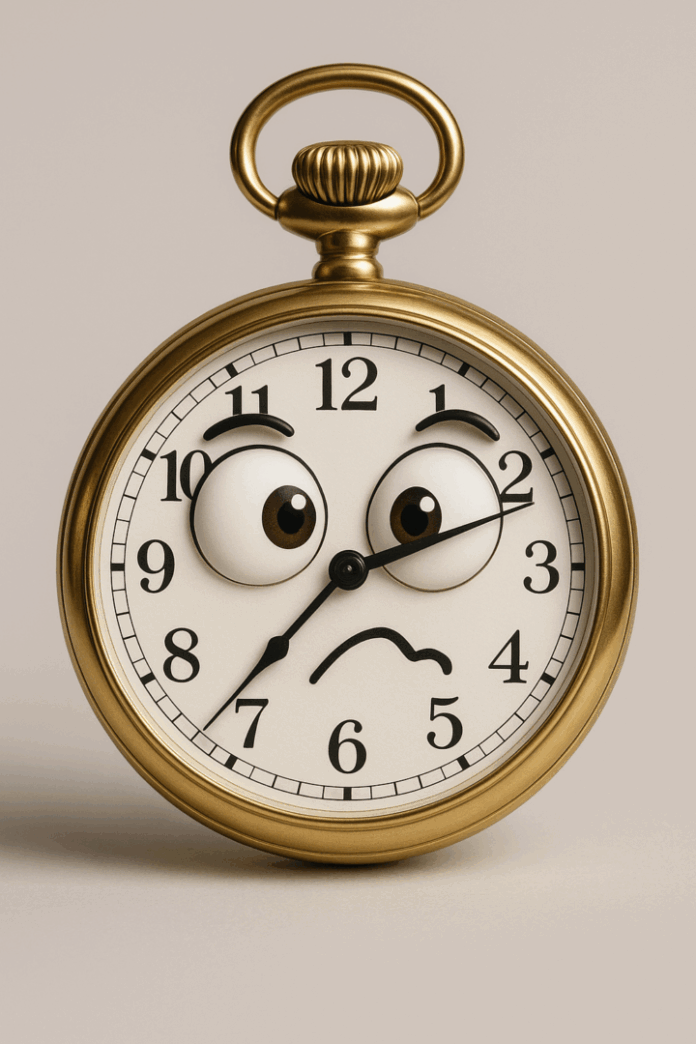
Ratingen | Schon wieder wird an der Uhr gedreht – als gäbe es nichts Einfacheres im Leben, als zweimal im Jahr kollektive Mini-Jetlags zu verteilen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 26. Oktober 2025, ist es wieder so weit: Um drei Uhr morgens wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Hurra, eine Stunde länger schlafen – und dafür eine Woche lang durcheinander sein. Aber im Grunde auch nicht, da der Großteil der Bevölkerung ja sowieso im Flow der flexiblen Zeitanpassung auf die eigene Life-Balance ist.
Offiziell kehren wir Sonntag zur „Normalzeit“ zurück, also zu dem, was früher ganz unaufgeregt Winterzeit hieß. Man könnte meinen, das wäre die perfekte Gelegenheit, einfach mal alles so zu lassen. Schließlich hat das EU-Parlament ja bereits 2019 beschlossen, diese halbjährliche Dreherei an den Zeigern abzuschaffen. Nur umgesetzt hat es bisher niemand. Der Beschluss verstaubt in Brüssel, irgendwo zwischen Bürokratie und Bedenkenmanagement.
Dabei war die Idee der Sommerzeit einst ein ernst gemeintes Experiment: Energie sparen, hieß es. Mehr Licht am Abend, weniger Stromverbrauch. Heute weiß man: Die Bilanz ist ernüchternd. Moderne Beleuchtung frisst kaum Energie, dafür laufen Klimaanlagen und Kühlschränke länger. Vom großen Sparpotenzial blieb wenig übrig.
Auch gesundheitlich steht die Umstellung längst auf der roten Liste. Ärzte und Chronobiologen warnen seit Jahren: Der plötzliche Eingriff in unseren Biorhythmus führt zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und – statistisch messbar – zu mehr Herzinfarkten in den Tagen nach der Umstellung. Von der „Erholung durch eine Stunde mehr Schlaf“ bleibt da nicht viel übrig.
Und wer glaubt, wenigstens die Wirtschaft profitiere, irrt ebenfalls. Die Bahn braucht Sonderfahrpläne, IT-Systeme müssen synchronisiert werden, und selbst manche Smartwatch kommt ins Grübeln, ob sie jetzt eine Stunde vor oder zurück soll. Nur die Kaffeebranche freut sich über einen kurzen Umsatzanstieg.
Eigentlich also alles klar: Kein nennenswerter Nutzen, nachgewiesene Nachteile – und trotzdem passiert nichts. Aber das passt vielleicht ganz gut in unsere Zeit. Denn die „gute alte Zeit“, in der sich das endlich vereinte Europa noch auf ein gemeinsames Handeln einigen konnte, scheint vorbei. Heute öffnet man jede Tür zur Lösung eines Problems nur, um dahinter ein ganzes Bündel neuer Unwägbarkeiten und konstruierter Probleme zu finden.
Also stellen wir am kommenden Sonntag brav, wie wir es gelernt haben, die Zeiger zurück – und vielleicht auch ein wenig die Erwartungen. Denn jeder weiß, bis März 2026 schaffen wir es ja sowieso nicht, diesen Unsinn endlich abzustellen. Ganz, ohne viel Zeitverlust, geht heute gar nichts mehr. Wir müssen bei solchen epochalen Entscheidungen von globaler Tragweite auch wirklich jedes Fitzelchen diskutieren, Abwägen, relativieren und dem Maßstab der neuen Generation entsprechend von uns weisen. Wir leben ja schließlich nicht mehr in den 1980ern, dieser Zeit wo einfach mal gemacht wurde.

